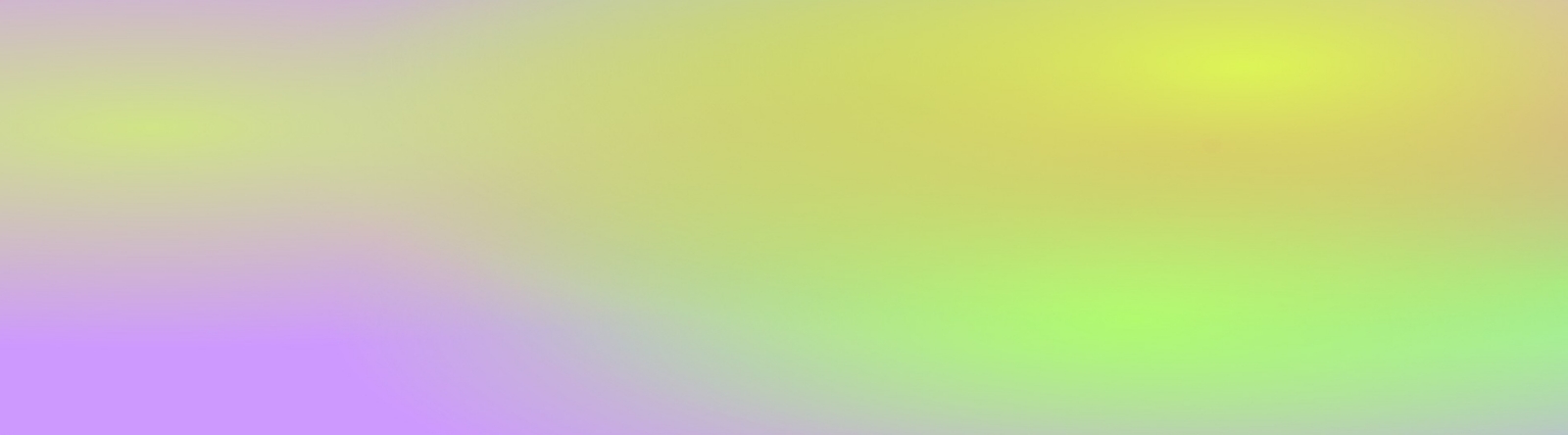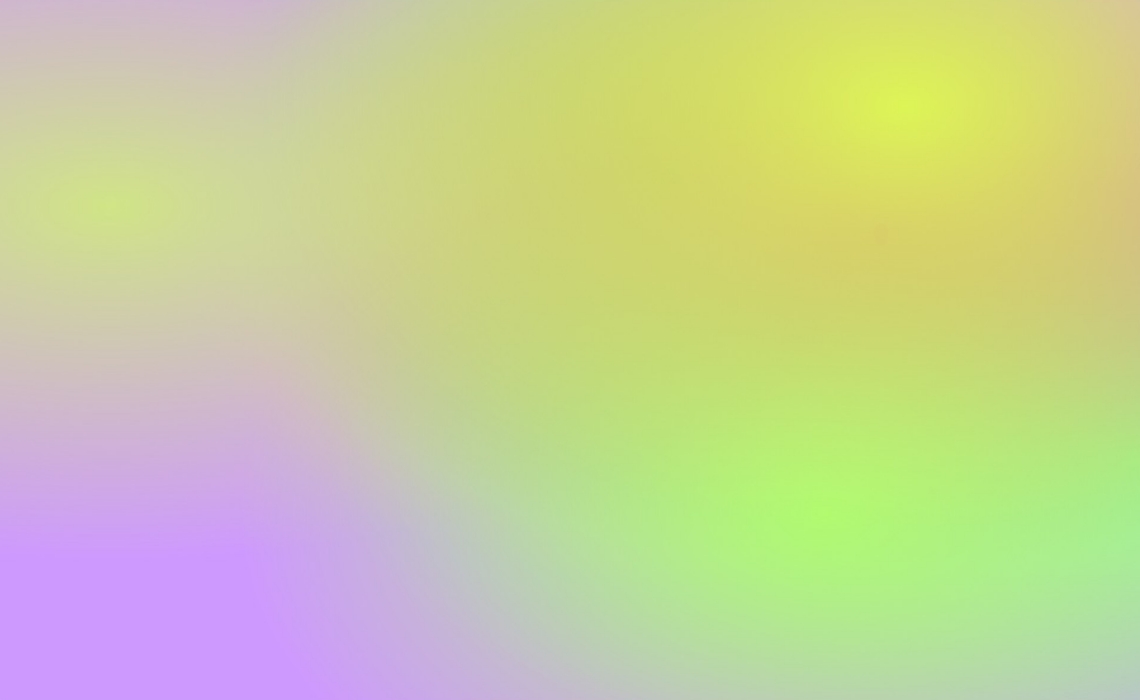Wer ist schuld? Mir egal.
Manchmal passiert etwas Blödes
Die Schuldfrage taucht auf, wenn etwas Unangenehmes bis Schlimmes vorgefallen ist:
- jemand ist verletzt
- etwas ist kaputtgegangen (das für irgendwen wichtig war)
- jemand hat etwas verloren (Geld, Gegenstände, Zuneigung)
Letzteres bringt mich schon zum Kern der Sache: die Schuldfrage tritt in Situationen auf den Plan, wo eine zwischenmenschliche Beziehung einen Knacks bekommen hat. Irgendwas ist passiert, und als Folge daraus steht eine Beziehung in Frage.
Unser Gehirn mal wieder
Das fühlt sich für uns Menschen als extrem soziale Wesen immer äußerst unangenehm an, denn unsere Steinzeitbiologie empfindet das schlichtweg als lebensbedrohlich. Und in früheren Zeiten, als unser Überleben noch sehr viel extremer und vor allem direkter von unserer unmittelbaren sozialen Gemeinschaft abhängig war, wäre es das unter Umständen auch gewesen.
Von daher ist klar, dass die älteren Teile unseres Gehirns in solchen Fällen massiv Alarm schlagen. Dafür verschafft es sofortige Erleichterung, wenn man einfach sagen kann: Ich war's nicht, mich trifft keine Schuld. Und damit man auch wirklich von möglichen Auswirkungen unbetroffen bleibt, gleich im Anschluss: Die war's. Richte deinen Zorn, deine Schadenersatzforderungen, deine Repressalien gegen die.
Und schwupps! schon bin ich aus dem Schneider. Jemand anders „kriegt es ab“. Überleben gesichert, fürs Erste.
Der Knackpunkt
Oberflächlich funktioniert das, und man kann damit durchs ganze Leben kommen. Aber – ist das mein Ziel? Möglichst unbeschadet durchs Leben kommen? Hauptsache überleben? Also, meins ist es nicht.
Sowieso geht es im heutigen Kontext ja auch in aller Regel nicht mehr ums physische Überleben, sondern um ein sozial-emotionales Bedürfnis: Wenn ich was verbockt habe, dann mag mein Gegenüber mich vielleicht nicht mehr. Vielleicht redet sie nie wieder mit mir. Vielleicht stehe ich auf ewig in ihrer Schuld (das ist das Wörtchen schon wieder!). Oder, manchmal das Allerschwierigste: wenn an meinem Verhalten etwas auszusetzen wäre, dann müsste ich daran konsequenterweise etwas ändern. Klingt aaaanstrengend!
Da ist es doch viel einfacher zu sagen – ich kann nichts dafür, jemand anders muss.
Blickwinkel ändern!
Man kann das auch anders sehen und angehen, wenn das Ziel anders definiert wird. Ich zum Beispiel möchte mein Leben in einem Netzwerk aus vielen guten, tiefen, respekt- und liebevollen Beziehungen verbringen. Solche Beziehungen entstehen aber nicht nur bei Sonnenschein, sie sind wie Pflanzen: Regen ist wichtig, und vor allem: unvermeidlich. Es ist einfach nicht möglich, eine tiefe Beziehung zu haben, in der nie etwas Blödes passiert!
Die wichtige Frage
Und darum ist die einzige Frage, die mich in einer zwischenmenschlich blöden Situation interessiert, folgende:
Wer übernimmt jetzt Verantwortung?
Das ist das einzige was interessant ist, PUNKT.
- Wer fegt die Scherben auf?
- Wer geht auf die anderen zu?
- Wer trifft Vorkehrungen, dass so etwas nicht wieder passiert?
Das Wichtige dabei: Ich schreibe niemandem vor, was sie tun muss. Verantwortung übernehmen beruht auf Freiwilligkeit, weil sie aus der eigenen Erkenntnis kommt. Den Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen wie ich, ist der Knacks in der Beziehung wichtiger als das oberflächliche Drumrum.
Was ist der Schmerz?
Und das ist auch etwas, was nicht offensichtlich ist: Das Problem ist ja nicht der heruntergefallene Teller oder das verlorene Geld oder was zwei Leute miteinander in einem Hotelzimmer gemacht haben. Das Entscheidende ist: Mindestens eine beteiligte Person verbindet damit negative Auswirkungen für sich selbst.
Manchmal ist diese negative Verbindung gleich klar, zum Beispiel wenn mich ein Auto anfährt. Körperliche Verletzungen sind für alle Menschen unangenehm. Aber sehr oft ist die Sache gar nicht so einfach. Wenn etwas kaputtgeht, sind Menschen manchmal wütend und manchmal traurig. Warum? Wütend vielleicht, weil sie den Vorfall als Unachtsamkeit gegenüber ihren Sachen interpretieren. Traurig vielleicht, weil es ein Erinnerungsstück von ihrer Oma war. Aber es gibt immer fast so viele Möglichkeiten und Nuancen, wie es Menschen und menschliche Beziehungen gibt.
Der wichtigste Teil der Verantwortung
Das Wichtigste in jeder Situation, in der jemand Verantwortung übernehmen möchte, ist daher die Aufnahme der Verbindung zum Gegenüber. Erstmal verstehe ich ihren Schmerz – falls ich einen eigenen habe, was auch nicht selten der Fall ist, muss ich mich darum vielleicht zuerst kümmern. Aber ohne das offene Ohr und die Frage nach dem Innenleben, den Gefühlen der anderen Person bleibt der Knacks in der Beziehung GARANTIERT.
Das wirklich Schwierige, das absolut Unangenehme daran ist: Man muss den Schmerz, die Wut, die Trauer, die Enttäuschung der anderen Person erstmal annehmen – und das bedeutet aushalten. So lange wie es eben dauert, bis sich der Zustand wandeln kann. Dieser Gedanke ist für viele Menschen so abschreckend, dass sie lieber bei oberflächlichen Beziehungen, sogar bei langjährigen Beziehungen mit ständig schwelenden Konflikten, bleiben.
Ein kleines Beispiel
Sagen wir, ich bin Mutter von zwei Kindern, werkele gerade in der Küche und höre aus dem Wohnzimmer, wie Porzellan zu Bruch geht. Ich gehe rüber und vor mir liegt eine große Vase in tausend Scherben zersprungen, daneben meine Kinder, die beide sofort rufen: „Ich war's nicht!“
Dann frage ich persönlich nicht, wer schuld ist, und wahrscheinlich nicht einmal, wie die kaputte Vase zustande kam (das ist eine ganz andere Frage wohlgemerkt, und oft eine nützliche). Was mich hauptsächlich interessiert ist – wer räumt das jetzt auf? Und ich würde sagen, wenn in meiner Familie sonst alles in Ordnung ist, dann holt ein Kind Schaufel und Kehrwisch und das andere den Staubsauger, und ich gehe einfach wieder in die Küche und weiß, dass die Scherben versorgt werden.
Ist denn alles in Ordnung?
Schon allein weil beide Kinder sofort „Ich war's nicht“ gerufen habe, vermute ich aber, dass nicht alles in Ordnung ist in unserem Familienleben. Vielleicht verstricken sich die Kinder in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Vielleicht stand die Vase auch außer Reichweite von Spielbewegungen an einem sicheren Platz. Vielleicht fühle ich mich getroffen und bin wütend und schreie erstmal rum (das passiert auch den besten von uns).
Wie übernehme ich Verantwortung?
Wie ich schon sagte: verantwortliches Verhalten muss aus freien Stücken kommen, und deshalb kann ich immer nur überlegen, wie ICH Verantwortung übernehmen kann. Was kann ich in dieser Situation tun?
Rahmen klären: Wenn die Kinder noch kleiner sind und der Unfall durch kindliches Rumtoben entstand, ist es meine Aufgabe als zuständige Erwachsene, sämtliche zerbrechlichen Gegenstände sicher außerhalb des Spielbereichs zu verwahren und unter Umständen auch den Spielbereich für die Kinder sehr klar zu definieren („ihr dürft im Spielzimmer toben, aber im Wohnzimmer nur ruhig spielen“).
In Kontakt gehen: Wenn ich die Kinder angeschrieen habe oder auch nur unspezifisch laut geworden bin, ist es absolut meine Aufgabe herauszufinden, was genau in mir los ist. Welche Bedeutung gebe ich dieser zerbrochenen Vase? Was ist mein Schmerz? Dann ist es meine Aufgabe, diesen Schmerz zu versorgen, und im Anschluss in Ruhe mit den Kindern zu sprechen und ihnen ganz explizit zu sagen, was mich zum Schreien veranlasst hat, dass sie daran keine Schuld tragen, dass ich sie immer noch lieb habe, und eventuell was ich mir für die Zukunft von ihnen wünsche, damit das nicht wieder passiert.
Härtefall
Sagen wir, die beiden Kinder sind schon älter, ich habe vor dem Unfall keine Tobegeräusche gehört, und die Vase stand definitiv völlig außer Spielreichweite. Womöglich steht noch ein hastig halb zurückgeschobener Stuhl herum. Mein erster Gedanke ist, dass das eigentlich nur vorsätzlich passiert sein kann, und die Vase war mir heilig. (Vielleicht war sie eine superteure Ming-Vase. Oder mein absolutes Lieblingsstück.)
In dieser Situation wird meine erste Reaktion vermutlich auch keine hilfreiche sein. Ich werde für mich und meine eigenen Gefühle erstmal ein paar Tage Zeit brauchen. Sagen wir, beide Kinder machen einen „schuldbewussten“ Eindruck, aber keines will es gewesen sein. Was tue ich jetzt?
Introspektive
Wenn ich voll in meine Verantwortung gehe, dann denke ich (nach der Versorgung meines Schmerzes) darüber nach, dass offensichtlich in meinem Familienleben etwas nicht stimmt. Glückliche, eingebundene, emotional versorgte Kinder steigen nicht auf Stühle, um an heilige, superteure Vasen heranzukommen. Irgendwas ist schon los – und wenn ich bereit bin, wirklich hinzuschauen, dann muss ich vielleicht einsehen, dass ich meinen Kindern in der letzten Zeit (womöglich schon jahrelang) sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und vielleicht erwähne ich die Heiligkeit dieser Vase mindestens zweimal die Woche.
Bewusst Beziehung gestalten
Ist mir die Vase wichtiger als die Beziehung zu meinen Kindern? Vermutlich nicht. Habe ich vielleicht diesen Eindruck erweckt? Gut möglich. Was tue ich also? Ich schenke meinen Kindern ganz bewusst mehr Aufmerksamkeit, ich gehe in Kontakt – sogar wenn sie das erstmal ablehnen, was in gewachsenen Situationen oft der Fall ist. Damit meine ich nicht, dass ich mich aufdränge, sondern dass ich DA bin. Auch wenn nochmal was passiert, auch wenn sie dicht machen, auch wenn ich wahrscheinlich erstmal mit Selbstzweifeln zu kämpfen habe (bin ich eine schlechte Mutter?). Dranbleiben und Beziehung gestalten.
Das wäre jetzt thematisch schon ein ganzes eigenes Blog. Was ich sagen will ist: Ich weiß nicht was aus dieser veränderten Haltung von mir entstehen würde. (Im Gegensatz dazu weiß ich ziemlich genau, was aus Schuldzuweisungen entsteht: mehr Schuldzuweisungen, sehr eingefahrene Muster, und wenn meine Kinder mal erwachsen sind, reden sie nicht mehr mit mir.) Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach einer Weile echter, ernster, verlässlicher Bemühungen meinerseits wieder aufmachen. Dass wir wieder reden und dass ich wieder weiß, was im Leben meiner Kinder los ist und wie es ihnen wirklich geht.
Und irgendwann, womöglich Jahre später, kommt vielleicht eines der beiden Kinder zu mir und sagt: „Du, Mama… das mit der Vase damals, das war ich. Ich wollte sie nur mal aus der Nähe anschauen, weil sie dir so wichtig war.“
Ich weiß nicht wie du das siehst – mir persönlich wäre das eine kaputte Ming-Vase absolut wert.
Mehr Macht = mehr Verantwortung!
Das war jetzt viel Text und ein, hm, unternehmensfremdes Beispiel. Das macht aber nix. Es ist in zwischenmenschlichen Situationen immer auch wichtig klar zu sehen, wer mehr Macht hat (oh, ein böses Wort, aber darüber schreibe ich wannanders). Im Beispiel mit den Kindern ist leicht ersichtlich, dass ich als Erwachsene deutlich mehr Macht habe: mehr Wissen, mehr Können, mehr Erfahrung, mehr Entscheidungsfähigkeit, mehr Freiheit. Und darum ist es auch sehr viel mehr meine Aufgabe, in die Verantwortung zu gehen und die Beziehung zu gestalten.
Zwischen Erwachsenen kann das gleichgewichtiger sein, aber auch hier gibt es oft Unterschiede: Ein Beispiel, das ich oft sehe und selber schon stark empfunden habe, sind „typische“ Mann-Frau-Beziehungen mit gemeinsamem Haushalt, in denen der Mann den Großteil des Geldes verdient. Das ist eine ungleiche Machtstruktur! Ein weiteres Beispiel sind Hierarchien in einem Angestelltenverhältnis.
Fazit für mich
Ich betrachte inzwischen mein ganzes Leben und alle meine Beziehungen konsequent unter diesem Aspekt. Wer geht in die Verantwortung? Und ganz ehrlich, die Antwort auf diese Frage trennt die Spreu vom Weizen. Je weniger jemand bereit ist, selbstverantwortlich zu denken und zu handeln, desto weniger ist mir eine gute, verlässliche Beziehung zu diesem Menschen möglich.
Das ist einfach so, und alle meine Bemühungen ändern daran unter Umständen nichts. Verantwortliches Handeln MUSS freiwillig entstehen.
Von daher begrenze ich den Platz, den schuldorientierte Menschen in meinem Leben einnehmen, auf das, was sich für mich stimmig anfühlt. (Dass ich selbständig bin und keine Chefin habe, ist bezeichnend – ich stelle nämlich hohe Ansprüche an eine Chefin!)
Fazit für Dich
Tja, was heißt das jetzt alles für Dich? Weiß ich nicht. Aber Du kannst das selber auf Dein Leben und natürlich genauso auf Dein Business übertragen, Du bist ja nicht doof. :-)
Und wenn Du bis hierhin gelesen hast und nicht aufgebracht bist, dann hast Du vermutlich selbst schon gemerkt, dass Dich die Schuldfrage nie weiterbringt. Wie konsequent setzt Du diese Erkenntnis um?